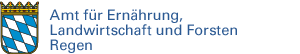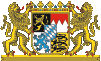Neue Wege am Demonstrationsbetrieb in Kollnburg
Zwischenfrucht per Drohne - ein erster Versuch
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
© Johannes Schlecht
Hohe Flächenleistungen und geringe Kosten wecken das Interesse der Landwirte an der neuen Technik der Zwischenfruchtansaat mittels einer Drohne. Betriebsleiter Johannes Schlecht vom Demonstrationsbetrieb Gewässerschutz in Raßmann bei Kollnburg hat im Herbst 2026 einen ersten Versuch gewagt: Er hat eine Zwischenfruchtmischung in einen abreifenden Winterweizenbestand einsäen lassen und dabei neue Erkenntnisse gewonnen.
"Nach der Ernte der Hauptfrucht ist auch keine Bodenbearbeitung mehr nötig, das spart Zeit und Kosten. Arbeitsspitzen im Herbst können so vermieden werden."
Silke Fischer, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regen

Versuch am Demonstrationsbetrieb:
Am Demonstrationsbetrieb entschied man sich für die Zwischenfruchtmischung „GeoVital G 100 K ZF“ mit 20 % Kresse, 30 % Weißer Senf (Sorte Gracja), 30 % Weißer Senf (Sorte King) und 30 % Ramtillkraut (Sorte Tilly). Die Aussaat erfolgte am 23. Juli 2025 mit einer Saatstärke von 13 kg/ha in den abreifenden Winterweizenbestand.
Bereits eine Woche nach der Einsaat, also am 30. Juli, zeigten sich erste Pflanzen.

© Johannes Schlecht
Der weitere Vegetationsverlauf zeigte jedoch auch die Regenerationsfähigkeit des Zwischenfruchtbestandes. Mitte September war der Bestand zwar weiterhin lückig, die Pflanzen hatten aber deutlich an Masse zugenommen und zeigen sich widerstandsfähig.
Der Betriebsleiter des Demonstrationsbetriebs Johannes Schlecht ist sich jedoch sicher:
"Die Zwischenfruchtsaat mit der Drohne ist auf jeden Fall einen weiteren Versuch im nächsten Jahr wert. Man muss sich aber bewusst sein, dass der Erfolg einer Drohneneinsaat noch viel mehr von äußeren Witterungsverhältnissen abhängt, wie die „normale“ Saat."